Direkte Demokratie in der BRD
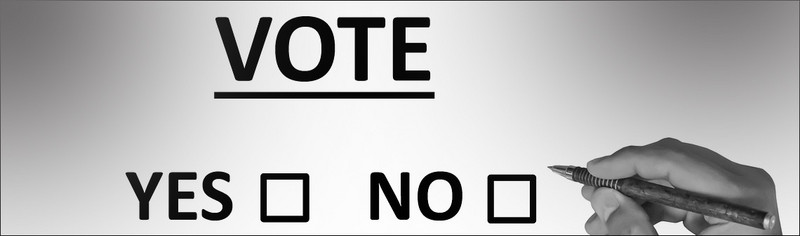
von Vincent Streichhahn
Demokratie ist die Herrschaft des Volkes – doch auf welche Entscheidungen haben die BürgerInnen der Bundesrepublik tatsächlich direkten Einfluss, und mit welchen Auswirkungen? Vincent Streichhahn zeichnet in seiner Hausarbeit ein facettenreiches Bild der Geschichte und der Gegenwart von Bürgerentscheiden.
Die Debatte zur repräsentativen und plebiszitären Demokratie wird in der BRD seit ihrer Gründung geführt - mitunter leidenschaftlich. Das Grundgesetz (GG) lässt hinsichtlich des Verhältnisses beider Modelle kaum Interpretationsspielraum. Im GG sind lediglich in zwei Fällen Plebiszite auf Bundesebene vorgesehen.1 Eine Ausweitung plebiszitärer Elemente bedürfte einer Grundgesetzänderung. Auf Länder- und Kommunalebene ist die Situation eine andere. Nach der Wiedervereinigung bot vor allem die Verfassungsgebung in den neuen Bundesländern eine günstige Gelegenheit für die Einführung direktdemokratischer Elemente. Die Entwicklung in den 1990er Jahren lässt sich einerseits mit der Attraktivität des Themas im Parteienwettbewerb und andererseits mit dem föderalen Nachahmungsdruck erklären, der auf der kommunalen Ebene einen regelrechten Dominoeffekt auslöste. Ab 1990 war der Bürgerentscheid beispielsweise in allen Kommunalverfassungen verankert. Hamburg fügte 1996 als letztes Bundesland den Volksentscheid in seine Landesverfassung ein.
Volksentscheide auf Bundesebene: Abgelehnt
Die Einführung auf Bundesebene ist jedoch weiterhin umstritten. Verschiedene Anläufe im Bundestag sind gescheitert. Die SPD hatte die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene bereits 1989 in ihr Berliner Grundsatzprogramm aufgenommen. Es sprach daher viel dafür, dass nach der rot-grünen Koalitionsbildung 1998 eine notwendige Grundgesetzänderung möglich gewesen wäre. Der Gesetzesentwurf verpasste jedoch im Juni 2002 mit 348 Ja-Stimmen und 199 Nein-Stimmen die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Nach der Schröder-Regierung (1998-2005) haben sowohl FDP, LINKE und GRÜNE weitere Gesetzesinitiativen diesbezüglich vorgelegt, jedoch fand keine von ihnen eine Mehrheit.2
Auf Landesebene: Mehrstufige Vielfalt
In den meisten Landesverfassungen sind drei verschiedene Verfahren verankert. Die Volksinitiative, beziehungsweise der Bürgerantrag, der in insgesamt 12 Bundesländern existiert, und das Volksbegehren, welches dem Volksentscheid vorgeschaltet ist. Durch die Volksinitiative besteht für die BürgerInnen die Möglichkeit, den jeweiligen Landtag mit einer geregelten Anzahl von Unterschriften zur Behandlung eines Themas zu zwingen. Volksbegehren und Volksentscheid können wiederum als zweistufiges Verfahren der Volksgesetzgebung3 betrachtet werden, die in allen Bundesländern in einer bestimmten Form geregelt ist.

Bevor die Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt werden können, muss ein Antrag auf Zulassung an die Landesregierung gerichtet werden. Wird dem Antrag stattgegeben, erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung und die InitiatorInnen haben je nach Bundesland unterschiedliche Fristen, um das Unterschriftenquorum zu erreichen.4 Eine große Hürde kann – abgesehen von dem Quorum, das von 3,7 Prozent in Brandenburg bis zu 20 Prozent in Hessen und dem Saarland reicht - der vorgeschriebene Ort der Stimmabgabe sein. So darf die Stimmabgabe in der Hälfte der 16 deutschen Bundesländer nur in einem öffentlichen Amt geschehen,5 was die Unterschriftensammlung massiv erschwert. Bei Nichterfüllung des Quorums ist das Volksbegehren gescheitert. Bei einem erfolgreichen Volksbegehren gibt es zwei Optionen. Entweder die GesetzgeberInnen nehmen den Vorschlag an oder lehnen ihn ab. Bei einer Ablehnung können die InitiatorInnen den rechtlich bindenden Volksentscheid anstreben.
Warum diese Zurückhaltung?
Es hält sich hartnäckig das Argument, dass Volksentscheide eine Verantwortung für das Scheitern des Weimarer Regierungssystems tragen würden. Sie waren dafür jedoch sowohl von ihrer Anzahl als auch thematisch viel zu beschränkt.6 Ebenso hinfällig ist das Argument, die Weimarer Erfahrung sei der Hauptgrund, warum sich die VerfassungsgeberInnen7 gegen die Aufnahme plebiszitärer Instrumente in das GG ausgesprochen hätten. „Das Argument kam erst später in Mode, als es galt, den anti-plebiszitären Konsens der Bonner Republik abzusichern“.8 Der strikt repräsentative Charakter des Grundgesetztes hatte laut Otmar Jung weniger mit der angeblich negativen Erfahrung von Weimar zu tun, als mit dem sich bereits abzeichnenden Kalten Krieg. Die VerfassungsgeberInnen schreckten vor der Einführung des Plebiszits auf Bundesebene zurück, da sie den Einfluss der Sowjetunion fürchteten. Diese historische Begründung der plebiszitären „Quarantäne“9 endete mit dem Mauerfall 1989. Fortan bedurfte es anderer Argumente, um den Verzicht auf plebiszitäre Elemente im Grundgesetz weiter zu rechtfertigen.10
Seit dem „Brexit-Votum“ vom Sommer 2016 mehreren sich Stimmen, die eine Unterminierung der liberalen Demokratie durch Volksentscheide befürchten. Dafür spricht, „(...) dass in Europa zunehmend rechtspopulistische Parteien Volksabstimmungen als ein wirkungsvolles politisches Instrument entdecken, um auf den Politikfeldern der Migration und europäischen Integration nationalistische Inhalte durchzusetzen, für die es in den nationalen Parlamenten keine Mehrheiten gäbe“.11 Die Schutz-, beziehungsweise Abkehrreflexe der politischen Elite in Deutschland stehen wiederum in einem Spannungsverhältnis zur Legitimität direktdemokratischer Verfahren, die in der Vergangenheit von verschiedenen Autoren aus der Legitimität des Demos als dem demokratischen Souverän hergeleitet wurde.12
Direkte Demokratie: Gefahr der Elitendemokratie
Doch sind Volksabstimmungen demokratischer als Wahlen? Der Hamburger Volksentscheid "Wir wollen lernen!" offenbart eine wenig diskutierte Gefahr direkter Demokratie. Die 2008 ins Amt gekommene schwarz-grüne Koalition beschloss eine Schulreform, die Kindern ein längeres gemeinsames Lernen ermöglichen sollte, um die Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft zu reduzieren. Gegen die Pläne organisierte sich Protest, der mit dem ersten erfolgreichen Hamburger Volksentscheid "Wir wollen lernen!" endete. Dieser wurde durch eine gut organisierte Kampagne gegen den Widerstand aller im Parlament vertretenden Parteien durchgesetzt. Die Kritik an dem Volksentscheid lautete, dass er in erster Linie ein Projekt des Bürgertums sei. Wie bei regulären Wahlen sind die Menschen mit niedrigem sozialen Stand der Abstimmung tendenziell eher ferngeblieben.13 Somit besaßen besser Gebildete und Verdienende einen Vorteil, die Abstimmung war sozial selektiv. Doch der soziale Charakter des Volksentscheids ist nicht nur im Abstimmungsverhalten zu suchen, sondern er wird bereits in der Phase der Initiation und Durchführung ersichtlich, die maßgeblich für den Erfolg war.
Direkte Demokratie bietet besser Gebildeten und Verdienenden große Einflussmöglichkeiten. Es geht schlussendlich um die sozialen Voraussetzungen, die es ermöglichen, sich überhaupt erst in den politischen Prozess einzubringen. „Die ‚demokratische‘ Illusion über die Demokratie besteht darin“, schreibt Pierre Bourdieu, „zu vergessen, daß es Zugangsbedingungen gibt für die konstituierte und öffentlich formulierte politische Meinung. (...) Folglich verbirgt sich hinter der formalen Gleichheit der Bürger eine tatsächliche Ungleichheit“.14 Eine Meinung zu einem politischen Problem zu äußern und in den politischen Prozess einzubringen, hängt immer noch maßgeblich davon ab, ob man gebildet oder ungebildet, ob man reich oder arm ist. Das stellt die Demokratie, sowohl in repräsentativer als auch plebiszitärer Form, vor enorme Herausforderungen.
1 Zunächst bei der Neugliederung des Bundesgebietes (Art 29 GG) und im Falle der Wiedervereinigung zur gesamtdeutschen Verfassungsgebung (Art. 146 GG). Die Nichtanwendung von Art. 146 ist bis heute umstritten. Während die h.M. in den Rechtswissenschaften argumentiert, dass der 1990 geänderte Artikel durch die Wiedervereinigung obsolet geworden sei, weisen andere auf seine Doppelfunktion hin. So sei die Wiedervereinigung nicht mit der Verfassungsgebung gleichzusetzen und die Option aus Artikel 146 bleibe weiterhin bestehen (vgl. Dreier 2009). Manche interpretieren das Vorgehen im Kontext der Wiedervereinigung sogar als Verfassungsbruch.
2 Vgl. Frank Decker, Das Volk als Gesetzgeber? Zur Diskussion über die Einführung von plebiszi-
tären Elemten auf Bundesebene. In: Regieren im Parteienbundesstaat. Zur Architektur der deut-
schen Politik. Wiesbaden, 2011, S. 165-216.
3 Volksgesetzgebung ist nicht mit direkte Demokratie gleichzusetzen, sondern es gibt noch andere direktdemokratische Instrumente, wie z.B. ein nicht bindendes Referendum oder die Abberufbarkeit von Personen aus bestimmten Ämtern. Sogar politische Parteien können als direktdemokratisches Element in einer repräsentativen Demokratie betrachtet werden.
4 Vgl. Andreas Kost, Direkte Demokratie. Wiesbaden, 2011, S. 61.
5 Vgl. ebd., S. 62f.
6 Vgl. Reinhard Schiffers, Schlechte Weimarer Erfahrungen?. In: Hans-Herbert von Arnim (Hg.).
Direkte Demokratie. Berlin, 2000, S. 51-65.
7 Es wird immer von den "Vätern des Grundgesetztes" gesprochen. Jedoch gehörten dem Parlamentarischen Rat, der mit der Ausfertigung des Grundgesetzes beauftragt wurde, immerhin vier Frauen an.
8 Siehe Decker 2011, S. 188.
9 Siehe Otmar Jung, Kein Volksentscheid im Kalten Krieg! Zum Konzept einer plebiszitären Qua-
rantäne für die junge Bundesrepublik 1948/49. In: ApuZ, 1992, S. 16-30.
10 GegnerInnen der Volksgesetzgebung klagen heutzutage meist über eine mögliche Überforderung der Entscheidungskompetenzen der BürgerInnen, über die Reduzierung komplexer Sachverhalte auf eine "ja" oder "nein"-Entscheidung und fehlende Kompromisslösungen.
11 Siehe Wolfgang Merkel/ Claudia Ritzi, Einleitung. In: Die Legitimität direkter Demokratie.
Wie demokratisch sind Volksabstimmungen? Wiesbaden, 2017, S. 1-8.
12 Vgl. Heidrun Abromeit, Nutzen und Risiken direktdemokratischer Instrumente. In: Offe, Claus (Hg.) Demokratisierung der Demokratie. Diagnosen und Reformvorschläge. Frankfurt
am Main. Campus. S. 95-110.
13Vgl. Arnim Schäfer et al., Prekäre Wahlen - Milieus und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung
bei der Bundestagswahl 2013. Studie Bertelsmannstiftung. Gütersloh, 2013.
14Siehe Pierre Bourdieu, Die Demokratie braucht Soziologie. In: ZEIT, 21. Juni 1996.








